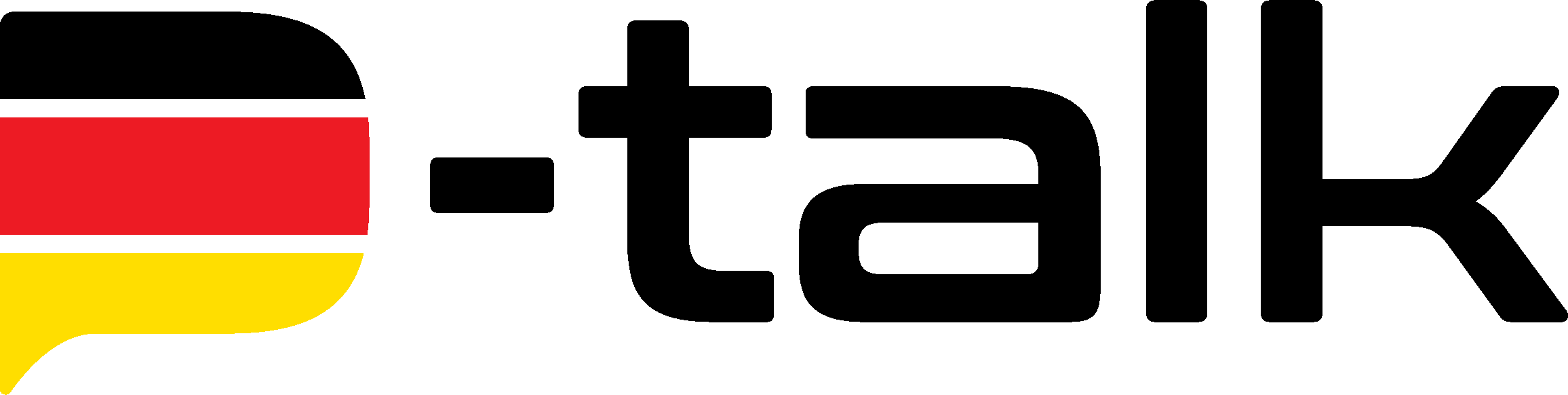Schulmädchen-Report Teil II: Alice Weidel im Gespräch mit Elon Musk
Am 9. Januar 2025 wurde der „Schulmädchen-Report“ auf ungewohnte Weise fortgesetzt. Diese Fortsetzung knüpfte zwar nicht direkt an den berühmten Film von 1970 an, der Millionen Zuschauer in die Kinos lockte, doch die Resonanz war ähnlich gewaltig. Diesmal handelte es sich um ein politisches Interview zwischen Alice Weidel, Vorsitzende der AfD, und dem US-Milliardär Elon Musk.
Bereits im Vorfeld war das Interesse enorm: Rund 150 EU-Beamte überwachten den Stream ,zudem hatten sich vorab zahlreiche Politiker und fast alle großen Medienanstalten zum Interview geäußert und forderten ein Verbot oder strenge Strafen. Erwartungsgemäß schürte es Kontroversen, da beide Gesprächspartner für ihre polarisierenden Äußerungen bekannt sind.
Harmonie zwischen Musk und Weidel
Das Interview verlief überraschend harmonisch. Besonders in der Anfangsphase wirkte Alice Weidel ungewöhnlich zurückhaltend, fast schüchtern – ein ungewohnter Eindruck im Vergleich zu ihren sonst dominanten Auftritten im Bundestag. Im Gespräch kam es auch zu philosophischen Überlegungen über die Besiedlung des Mars. Musk betonte, dass die Menschheit nicht von einem einzigen Planeten abhängig bleiben dürfe. Weidel stimmte zu, auch wenn einige ihrer Aussagen im Detail für Verwirrung sorgten.
Musk nahm dies gelassen und nutzte gelegentlich humorvolle Bemerkungen, um die Stimmung aufzulockern. Diese Gesten trugen dazu bei, dass Weidel im Gespräch sympathischer wirkte.
Politische Themen: Bildung, Bürokratie und Energie
Zu konkreten politischen Themen fanden Musk und Weidel teils gemeinsame Ansichten. Beim Thema Bildungspolitik kritisierte Weidel, dass deutsche Schulen zunehmend Defizite zeigten: „Die jungen Leute lernen nichts mehr – weder Mathematik noch vernünftiges Deutsch.“ Musk zeigte sich überrascht und erwiderte, dass er bislang einen guten Eindruck vom deutschen Bildungssystem gehabt habe. Er nahm jedoch Weidels Argument auf, dass sich die Ergebnisse der Pisa-Studien in den letzten Jahren verschlechtert hätten.
Ein weiteres Thema war die Bürokratie. Musk, der mit seiner Tesla-Fabrik in Brandenburg persönlich Erfahrung mit der deutschen Verwaltung gesammelt hat, berichtete von 25.000 Seiten an Formularen und Regularien, die erforderlich waren, um den Standort in Betrieb zu nehmen. Er bemängelte zudem, dass viele Dokumente nur in Papierform akzeptiert wurden, obwohl digitale Alternativen längst möglich seien.
Bei der Energiepolitik betonte Musk seine Vorliebe für Solarenergie und warnte vor einseitigen Abhängigkeiten. Weidel stimmte zu, dass eine Diversifizierung der Energiequellen wichtig sei.

Diskussion über Medien und politische Labels
Ein besonders brisantes Thema des Interviews war die Darstellung der AfD in den Medien. Musk sprach an, dass die Partei häufig als „extrem rechts“ dargestellt werde, was oft mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werde. Weidel nutzte diese Vorlage, um eine kontroverse Behauptung aufzustellen: Hitler sei in Wahrheit ein „kommunistischer Sozialist“ gewesen.
Diese Aussage sorgte für einige Verwirrung, doch Musk ließ das Thema unkommentiert stehen.
Reaktionen und öffentliche Wahrnehmung
Das Interview wurde live auf X (ehemals Twitter) ausgestrahlt und von einigen deutschen Plattformen simultan ins Deutsche übersetzt. Insgesamt sahen etwa 500.000 Menschen zu. Trotz der hohen Zuschauerzahlen waren viele enttäuscht: Weder Weidels Unterstützer noch ihre Gegner fanden das Gespräch besonders spektakulär. Auch die 150 EU-Beobachter, die Verstöße gegen EU-Recht suchten, blieben erfolglos.
Bemerkenswert war weniger das Interview selbst, sondern das Medienspektakel, das im Vorfeld veranstaltet wurde. Diskussionen über eine mögliche Verhinderung des Interviews oder Sanktionen gegen Musk und X führten dazu, dass das Event eine Aufmerksamkeit erlangte, die fast an ein WM-Finale erinnerte.
Fazit: Meinungsfreiheit unter Druck?
Nicht das Interview selbst, sondern das ganze Primborium im Vorfeld und im Zusammenhang mit dem Gespräch sorgte für Besorgnis.
Die Diskussionen über mögliche Verbote, Sanktionen gegen X oder gar gegen Elon Musk sowie die Versuche, das Ereignis zu skandalisieren, werfen Fragen zur Meinungsfreiheit auf. Kritiker sehen darin ein Muster: Es geht zunehmend darum, den öffentlichen Diskurs zu kontrollieren und festzulegen, wer was sagen darf und was nicht.
Ein solcher Umgang mit unliebsamen Meinungen erinnert manche Beobachter an historische Beispiele, wie das „Schriftleitergesetz“ der Nationalsozialisten, das 1933 die Pressefreiheit abschaffte und streng reglementierte, wer für die Öffentlichkeit schreiben durfte.